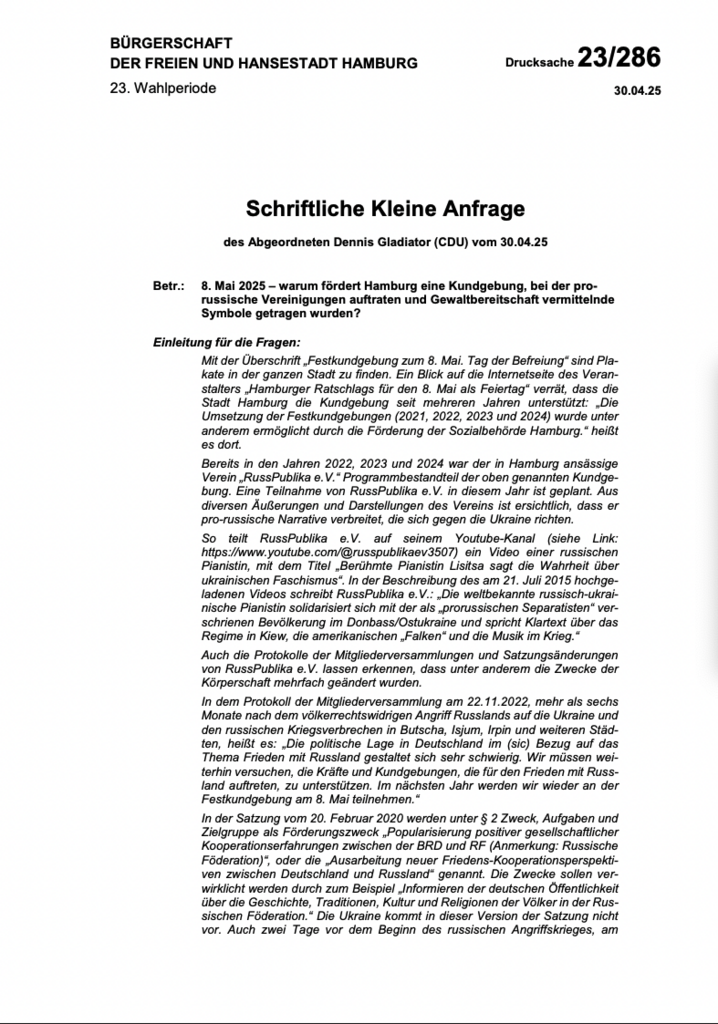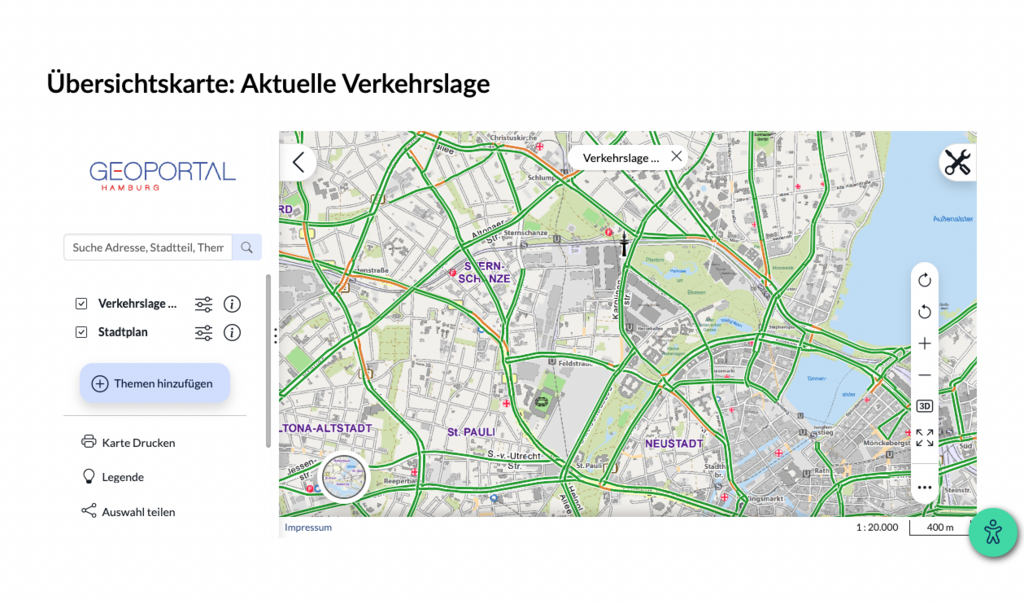Die Senatssitzung
Nach der Senatsvorbesprechung findet an jedem Dienstag die Senatssitzung statt. Sie wird in der Ratsstube unter Vorsitz des Ersten Bürgermeisters abgehalten. An einem hufeisenförmig aufgestellten Eichentisch sitzen der Erste Bürgermeister, die Zweite Bürgermeisterin, die Senatorinnen und Senatoren, die Staatsrätinnen und Staatsräte und die Leitung der Pressestelle des Senats. An einem kleinen Seitentisch haben die Erste und Zweite Protokollführerin Platz genommen.
Für die Sitzordnung der Senatorinnen und Senatoren ist deren Amtsdauer ausschlaggebend. Es beginnt neben den Bürgermeistern, die unter einem Baldachin am Kopf des hufeisenförmigen Tisches auf Stühlen mit erhöhter Lehne sitzen. Neben ihnen sitzen diejenigen, die am längsten „dabei“ sind. Am unteren Ende des Tisches sind die „Neulinge“ platziert. Sofern sie das gleiche Amtsalter haben, richtet sich deren Sitzordnung nach deren Lebensalter (§ 13 Abs. 4 SenGO).
„Die in Hamburg anwesenden Mitglieder des Senats und des Staatsrätekollegiums sind verpflichtet, an den Sitzungen des Senats teilzunehmen, soweit sie nicht durch Krankheit oder aus wichtigen Gründen, die dem Ersten Bürgermeister mitzuteilen sind, daran gehindert sind“ (§ 14 Abs.1 SenGO).
„Die Tagesordnung der Sitzungen des Senats bestimmt der Erste Bürgermeister vorbehaltlich eines abgeänderten Beschlusses, den der Senat zu Beginn der Sitzung fasst. Die Tagesordnung ist vertraulich.“ Sie „soll spätestens sechs Tage vor der Senatssitzung den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorliegen“ (§ 15 Abs. 1 und 4 SenGO).
Alles, worüber in der Senatssitzung berichtet werden soll, ist grundsätzlich durch eine Senatsdrucksache vorzubereiten (§ 16 Abs. 1 SenGO). Dies geschieht durch die Senatsämter oder Fachbehörden. Die Drucksachen sind nicht für die Allgemeinheit bestimmt. Sie sind vertraulich, manchmal sogar streng vertraulich.
Entsprechend ihrem „vertraulichen“ Status gibt es verschiedene Verteilerkreise, die die Drucksachen erhalten, z.B. die den einzelnen Senatorinnen und Senatoren unterstellten Fachbehörden („Ministerien“ – wie sie in den bundesdeutschen Flächenländern auch heißen (§ 16 Abs. 2 u. 3, 4 u. 5 SenGO)).
In den Senatssitzungen berichten die Senatorinnen und Senatoren sowie die Staatsrätinnen und Staatsräte über wichtige, eine Entscheidung des Senats bedürfende Angelegenheiten aus ihren Behörden und Ämtern. Außerdem informieren die jeweils verantwortlichen Senatsmitglieder einer Senatskommission den Senat über die Arbeit in den Kommissionen.
Senatsbeschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst (§ 18 Abs. 1 SenGO). Die Abstimmung geschieht durch Handzeichen. Es gibt auch die Möglichkeit der schriftlichen (geheimen) Abstimmung und zwar dann, wenn ein Mitglied des Senats dies beantragt (§ 18 Abs. 3 SenGO).
„Bei schriftlicher (geheimer) Abstimmung sammelt das amtsjüngste, bei gleichem Amtsalter das lebensjüngste Mitglied des Staatsrätekollegiums die Stimmzettel in der Wahlurne ein, zählt die Stimmen aus und teilt das Ergebnis dem vorsitzführenden Mitglied des Senats mit“ (§ 18 Abs. 6 SenGO).
Stimmenenthaltungen werden bei der Beschlussfassung nicht berücksichtigt. Sollte es zu einer Stimmengleichheit kommen, hätte das vorsitzende Senatsmitglied – meistens der Erste Bürgermeister, bei seiner Abwesenheit die Zweite Bürgermeisterin – das letzte Wort. Bei Koalitionen gibt es die Vereinbarung, dass kein Koalitionspartner überstimmt wird.
Auf eine Abstimmung verzichtet werden kann, wenn es unter den Mitgliedern des Senats zu einem Antrag oder Vorschlag keinen Widerspruch gibt.
Die Senatsmitglieder müssen gemäß Art. 42 Abs. 2 HV in ihrer Funktion als Leiterinnen und Leiter von Behörden und Senatsämtern dem Senat folgende „Dinge“ zur Beschlussfassung vorlegen:
-
„Angelegenheiten, die von grundsätzlicher oder allgemeiner Bedeutung sind oder die gesamte Verwaltung betreffen“.
-
Beispiel: übergreifende Konzepte, die die gesamte Stadt betreffen – wie z.B. die Hamburger Drogenpolitik oder die SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung.
-
-
„Meinungsverschiedenheiten über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer Verwaltungsbehörden oder Senatsämter berühren“.
-
Beispiel: ein eventueller Interessenkonflikt zwischen der Innenbehörde und der Sozialbehörde zum Thema Drogenkriminalität/Prävention.
-
-
„Alle an die Bürgerschaft zu richtenden Anträge“.
-
Beispiel: Schriftliche Senatsvorlagen zu bestimmten politischen Themen, für die der Senat die Zustimmung der Bürgerschaft benötigt. Zum Beispiel braucht der Senat die Zustimmung der Bürgerschaft für Angelegenheiten, für die der Senat Haushaltsmittel benötigt, wie für den Straßen-, Brücken- und Schulbau und diese nicht schon durch den Haushaltsplan von der Bürgerschaft bewilligt worden sind.
-
Die Bürgerschaft muss nicht zu jedem Senatsantrag eine Debatte führen. Viele Anträge sind bereits in Ausschüssen besprochen worden. Wenn in der Bürgerschaft über solche Anträge kein weiterer Erörterungsbedarf besteht, kann in der Bürgerschaft der Antrag des Senats ohne Debatte abgestimmt werden.
-
„Angelegenheiten, die mit Organen des Bundes, anderer Länder oder des Auslandes verhandelt werden“ müssen.
-
Angelegenheiten, über die die Verfassung oder ein Gesetz festlegen, dass der Senat dafür zuständig ist.
-
Beispiele: Beschluss über die Geschäftsverteilung, d.h. die Zuständigkeit der Mitglieder des Senats (Art. 42 Abs. 2 HV); Ratifizierung von Staatsverträgen (Art. 43 HV).
-
Die Senatsvorbesprechung
Jeden Dienstag vor der Senatssitzung findet die Senatsvorbesprechung unter Vorsitz des Ersten Bürgermeisters statt. Dabei handelt es sich um eine Vorberatung der Senatssitzung. Daran nehmen aktuell alle Mitglieder des Senats, der Chef der Senatskanzlei, der Pressesprecher und die stellvertretende Pressesprecherin des Senats, die Bevollmächtigte beim Bund sowie die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen (SPD und DIE GRÜNEN) teil. Doch auch diese Vorbesprechung bedarf einer Vorbesprechung – dies allerdings nach Fraktionen räumlich getrennt.
Die Senatskanzlei
Als Schaltstelle der Regierungspolitik betreut und koordiniert die Senatskanzlei die Arbeit des Senats.
Sie unterstützt den Ersten Bürgermeister bei seinen Amtsgeschäften (§ 5 Abs. 1 SenGO).
Die Senatskanzlei plant das Regierungsprogramm, setzt die politischen Richtlinien des Bürgermeisters um, übernimmt die Investitionsplanung und koordiniert die Fachbehörden.
Sie ist außerdem zuständig für Veranstaltungen im Rathaus sowie Staatsbesuche und pflegt die internationalen Beziehungen.
Zu den Aufgaben gehört auch die Information der Öffentlichkeit über die aktuelle politische Arbeit:
https://www.hamburg.de/senatskanzlei/wir-ueber-uns/.
Zur Senatskanzlei gehören u.a.:
- das Bürgermeisterbüro
- der Planungsstab
- die Pressestelle des Senats
- das Staatsamt, wozu z.B. das Hanse-Office in Brüssel gehört
- die Vertretung der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund
- die Bevollmächtigte beim Bund
Einige Aufgabenbereiche der Senatskanzlei:
- Konzeption und Controlling des Regierungsprogramms und der vom Ersten Bürgermeister bestimmten Richtlinien der Politik
- Strategische Aufgabenplanung, Steuerung und Koordinierung der Arbeitsschritte zur Umsetzung der politischen Zielsetzungen des Senats
- Investitionsplanung und Ressourcensteuerung
- Entscheidungsplanung und Drucksachenmanagement für den Senat
- Wahrnehmung der Interessen Hamburgs gegenüber der Bundesregierung und den anderen Bundesländern sowie die Pflege der Beziehungen zum Ausland
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Arbeit des Senats
Geheimhaltung
„Das Ergebnis von Abstimmungen und die Stimmabgabe der einzelnen Mitglieder des Senats sind geheimzuhalten“ (§ 20 Abs. 1 SenGO).
Das Gleiche gilt auch für den Inhalt der Beratungen. Um eine geheime Beratung zu sichern, gibt es in der Ratsstube Doppeltüren. Früher machten sich Ratsdiener, die dem Senat eine dringende Nachricht zu überbringen hatten, bemerkbar, indem sie eine Klappe an der Außentür zur Ratsstube öffneten und mit einem Stock gegen die innere Tür pochten. Der Protokollführer nahm dann die Nachricht zwischen äußerer und innerer Tür entgegen. Heute wird nicht mehr an die Tür geklopft, sondern draußen ein Knöpfchen gedrückt, das in der Ratsstube ein Lämpchen am Tisch der Protokollführerinnen aufleuchten lässt.
Der Senat kann im Anschluss an die Senatssitzung die Presse über die gefassten Senatsbeschlüsse informieren – muss es aber nicht (§ 20 Abs. 3 SenGO). Außerdem sind die Beschlüsse seit dem Jahr 2012 in einem Informationsregister zu veröffentlichen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 HmbTG).
Senatskommission
Zur Entlastung und Unterstützung seiner Arbeit kann der Senat Senatskommissionen bilden. In ihnen arbeiten Senatorinnen und Senatoren und Staatsrätinnen und Staatsräte (§ 6 Abs. 1 SenGO). Letztere haben hier, im Gegensatz zu den Senatssitzungen, Stimmrecht. Über den Vorsitz in einer Senatskommission entscheidet der Senat. Es gibt zwei mit unterschiedlichen Kompetenzen versehene Arten von Senatskommissionen:
-
Die eine entscheidet für den Senat (hat beschließende Funktion),
-
die andere hat nur beratende Funktion.
Finanzangelegenheiten
Bevor der Senat Investitionen tätigt, muss zunächst die Finanzbehörde eingeschaltet werden (§ 9 Abs. 1 SenGO). Investitionen, die nicht bereits durch den Haushaltsplan abgesegnet wurden, Geldnachbewilligungen und Anträge auf Investitionen, die bei mehr als 500.000 EUR liegen oder von besonderer Bedeutung sind, müssen, bevor der Senat darüber beschließt, vom Planungsstab der Senatskanzlei begutachtet werden (§ 9 Abs. 2 SenGO).
„Angelegenheiten von finanzieller Bedeutung sollen im Senat nur verhandelt werden, wenn der Präses oder der stellvertretende Präses der Finanzbehörde anwesend ist“ (§ 19 Abs. 1 SenGO).
Kommt es zu einem Beschluss, dem der Finanzsenator nicht zustimmen kann, hat er die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen (§ 19 Abs. 2 SenGO). Dann muss in einer späteren Sitzung noch einmal darüber abgestimmt werden. Gegen die Stimme des Finanzsenators können nur mit der Mehrheit des gesamten Senats Beschlüsse gefasst werden.
„Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzführenden Mitglieds des Senats“ (§ 19 Abs. 3 SenGO).
Das ist in der Regel der Erste Bürgermeister. Wenn es um Investitionen geht, soll darüber nur dann verhandelt werden, wenn der Erste Bürgermeister oder der Finanzsenator anwesend ist.
Gleichstellungsangelegenheiten
Im Hinblick auf die Prüfung gleichstellungspolitischer Belange sind alle Vorlagen mit derjenigen Behörde abzustimmen, die für Gleichstellung zuständig ist, bevor sie dem Senat vorgelegt werden. Aktuell ist das die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung (BWFG).
Soweit der Öffentliche Dienst betroffen ist, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Freien und Hansestadt Hamburg, ist auch das Personalamt zu beteiligen und dieses stimmt seine Stellungnahme mit der BWFG ab.
Außerdem haben die Behörden „die Auswirkungen ihrer beabsichtigten Maßnahmen auf gleichstellungspolitische Belange in der Senatsdrucksache darzustellen“ (§ 10a, Abs. 1 und 2 SenGO).
Rechtsangelegenheiten
Bei Rechtsfragen oder Vorlagen, die den Erlass von Gesetzen und Verordnungen betreffen, muss die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz angehört werden, bevor sich der Senat damit beschäftigt und bei grundsätzlichen staats- und verfassungsrechtlichen Fragen auch die Senatskanzlei (§ 10 SenGO).
Das Einkommen der Senatorinnen und Senatoren
„Mit dem Amt der Mitglieder des Senats ist die Ausübung jedes anderen besoldeten Amtes und jeder sonstigen Berufstätigkeit unvereinbar“ (Art. 40 Abs. 1 HV).
Damit soll gewährleistet werden, dass die Senatorinnen und Senatoren sich voll und ganz auf ihr Amt konzentrieren. Außerdem soll damit der Gefahr begegnet werden, dass Mitglieder des Senats wegen einer Arbeit außerhalb des Senats in Interessenkonflikte geraten könnten.
Sie dürfen aber – ohne materiellen Gewinn daraus zu ziehen – Aufsichtsratsposten in Unternehmen übernehmen. Allerdings muss dies mit dem Senat und der Bürgerschaft abgestimmt sein (Art. 40 Abs. 2 HV).
Die Senatorinnen und Senatoren dürfen kein Bürgerschaftsmandat ausüben (Art. 39 Abs. 1 HV). Besitzen sie eins, ruht dieses während ihrer Amtszeit (Art. 39 Abs. 2 HV). Zweck dieser Vorschrift ist es, Interessenkonflikten vorzubeugen, die sich aus der unterschiedlichen Aufgabenstellung von Senat und Bürgerschaft ergeben.
Die Mitglieder des Senats erhalten 123 Prozent des Grundgehaltes der Besoldungsgruppe B 11 des Hamburgischen Besoldungsgesetzes; das sind aktuell über 17.000 Euro brutto im Monat.
Dazu erhalten sie monatliche Aufwandsentschädigungen in unterschiedlicher Höhe sowie Tagegelder und Reisekosten bei Amtsgeschäften außerhalb Hamburgs (§ 12 SenG).
Übergangsgeld:
Senatorinnen und Senatoren, die aus ihrem Amt ausscheiden, erhalten für die Dauer der Amtszeit mindestens für drei, längstens für 24 Monate Übergangsgeld (§ 13 SenG).
Ein ehemaliges Mitglied des Senats erhält im Anschluss an die Amtsbezüge Ruhegehalt, wenn er sein Amt mindestens vier Jahre oder für eine nicht nach Artikel 11 (Vorzeitige Beendigung der Wahlperiode durch die Bürgerschaft) der Hamburger Verfassung beendete Wahlperiode bekleidet hat (§ 14 Abs. 1 S. 1 SenG).
Existieren Ansprüche auf Übergangsgeld und Ruhegehalt nebeneinander, so wird nur der höhere Betrag gezahlt (§ 16 Abs. 1 SenG). Die Berechnung richtet sich in erster Linie nach der Dauer der Zugehörigkeit zum Senat. Der maximal zu erreichende Ruhegehaltssatz liegt zurzeit bei 71,75 Prozent.
Aberkennung von Ruhegehalt und Übergangsgeld:
„Hat ein amtierendes oder ein ehemaliges Mitglied des Senats seinen Amtspflichten erheblich zuwidergehandelt oder sich während oder nach seiner Amtszeit durch sein Verhalten der Achtung, die das Amt erfordert, unwürdig gezeigt, so kann der Anspruch auf Ruhegehalt, Übergangsgeld und Hinterbliebenenversorgung ganz oder teilweise aberkannt werden. Die Aberkennung erfolgt auf Antrag des Senats durch das Hamburgische Verfassungsgericht“ (§ 17 SenG).
Hamburg und die Regierungen anderer Länder
Die mehrfach im Jahr stattfindenden Besprechungen der Regierungschefinnen und -chefs der deutschen Bundesländer mit der Bundeskanzlerin sowie die Konferenzen der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien und die Ministerpräsidentenkonferenzen werden von einer Abteilung der Senatskanzlei im Planungsstab vorbereitet.
Diese Konferenzen dienen – wie auch die Fachministerkonferenzen – der Selbstkoordinierung der Länder im kooperativen Föderalismus.
Beschlüsse in Sachfragen kommen in der Regel nur bei Einstimmigkeit zustande.
Sie entfalten keine unmittelbaren Rechtswirkungen, haben jedoch als Empfehlungen politische Bindungskraft.
Bearbeitet werden in der Senatskanzlei auch die Abschlüsse von Staatsverträgen und Abkommen zwischen Bund und Ländern, die dem Senat zur Beschlussfassung vorzulegen sind.
„Für alle Übereinkünfte zwischen Hamburg und dem Bund und anderen Bundesländern soll grundsätzlich die einheitliche Bezeichnung ‚Abkommen’ gewählt werden. Die Benennung ‚Staatsvertrag’ soll eine Übereinkunft nur dann erhalten, wenn dies mit Rücksicht auf die besondere Eigenart und Bedeutung des Abkommens oder auf die Auffassung des Abkommenspartners erforderlich ist.“
(Teil 1 Ziffer 1 der „Richtlinie für das Verfahren beim Abschluss von Abkommen“ vom 11. Februar 1980).
Es gibt aber auch Abkommen, die der Zustimmung der Bürgerschaft bedürfen. Hierzu gehören u. a.:
-
Abkommen, die Gegenstände der Gesetzgebung betreffen
-
Abkommen über Veränderungen des Hoheitsgebietes
-
Abkommen, die vom hamburgischen Recht abweichende Regelungen vorsehen
-
Abkommen, durch die Hoheitsrechte übertragen werden
-
Abkommen, für deren Folgekosten keine Haushaltsmittel bewilligt sind
Zusätzlich wird von der Senatskanzlei die Funktion der Landesgeschäftsstelle Hamburg des Deutschen Städtetages (DST) wahrgenommen.
Norddeutsche Zusammenarbeit und Europapolitik
Eine Abteilung des Planungsstabs der Senatskanzlei ist für die norddeutsche Zusammenarbeit sowie länderübergreifende Kooperationen zuständig.
Ziel bei bi- oder multilateralen Kooperationen ist insbesondere eine Profilbildung und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des gesamten norddeutschen Raumes.
Die Abteilung Angelegenheiten der Europäischen Union im Staatsamt der Senatskanzlei bringt Hamburger Interessen in die europäischen Entscheidungsprozesse ein.
Sie arbeitet an zwei Standorten:
-
dem Hanse-Office in Brüssel, der gemeinsamen Vertretung der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein
-
dem Referat Europapolitik in Hamburg
Zu ihren Hauptaufgaben gehört es, die Interessen des Senats in Brüssel, insbesondere gegenüber der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, zu vertreten.