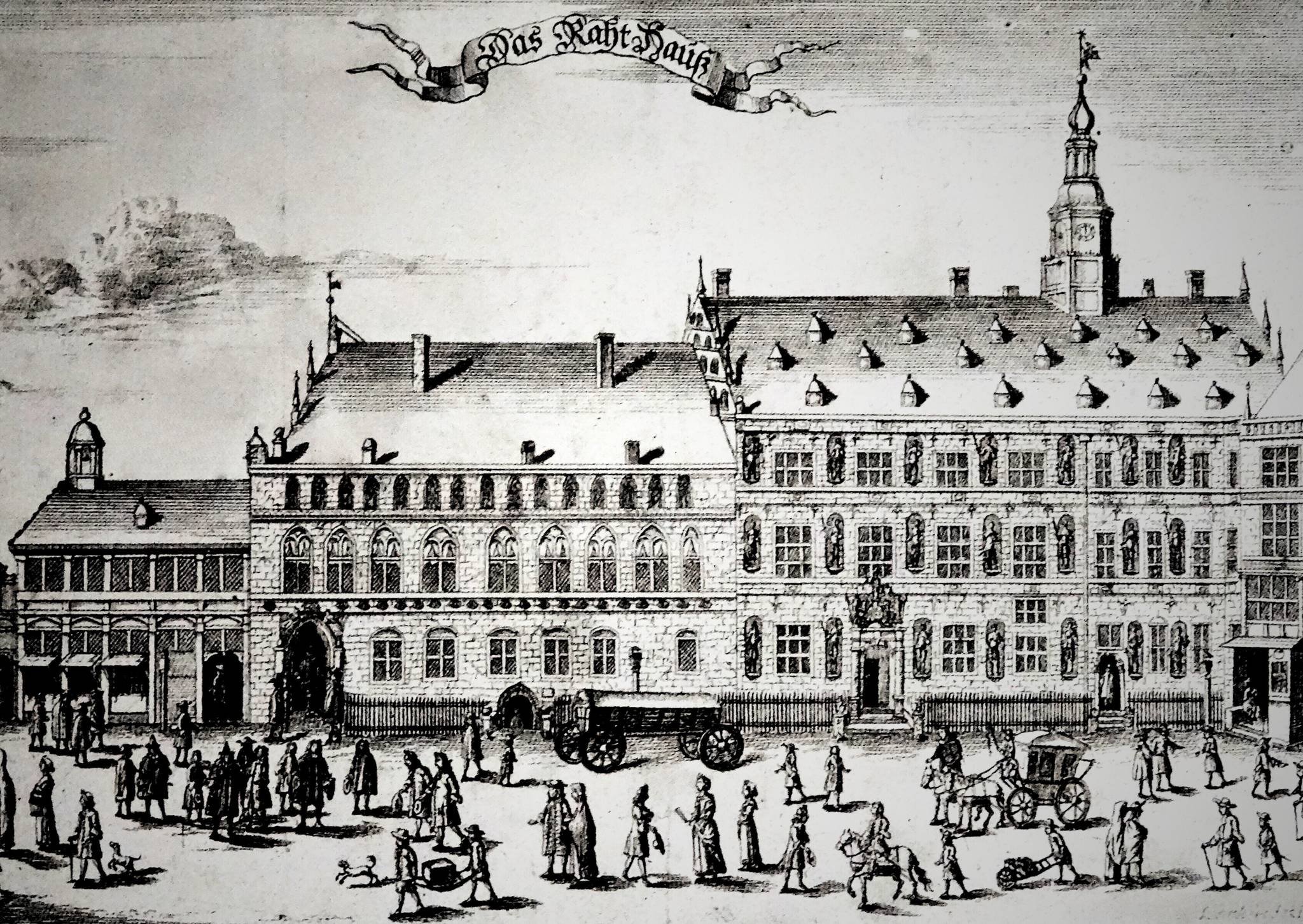Die Bürgerschaft ist die gesetzgebende Gewalt, also die durch Wahlen demokratisch gewählte Vertretung der Bürgerinnen und Bürger. In den Flächenländern heißt die Legislative meistens Landtag.
Ein Bilderfries aus alter Zeit prangt im Bürgerschaftstreppenhaus vor den Eingängen zum Plenarsaal: Zwei wackere Handwerker im mittelalterlichen Gewand zeigen auf die Inschrift: „Tritt ein in Bürgergilden und leiste Bürgereid.“
Aber wer durfte in Bürgergilden eintreten? Vor dem 15. Jahrhundert konnten nur wenige Einwohner Hamburgs Bürger werden. Den Bürgereid zu erwerben, war eine kostspielige Angelegenheit, mussten doch mit dem Treueschwur an die Stadt auch bestimmte Pflichten übernommen werden, wie Steuerzahlung und Stadtverteidigung. Nur Männern war der Eintritt in die Bürgergilde möglich. Dafür gab es dann aber auch diverse Privilegien. Der Bürger durfte ein selbstständiges Geschäft betreiben, Grundeigentum erwerben, heiraten und die Bürgerschaft wählen.
1848 Ausweitung des Bürgerrechts
Beeinflusst durch die Ideen der bürgerlichen Revolution von 1848 wollte nun auch ein Großteil derjenigen Einwohner Hamburgs Bürger werden, denen das bislang verwehrt worden war. 1860 kam es deshalb zur Verfassungsreform: Von nun an erhielten alle männlichen, über 25-jährigen Einkommensteuer zahlenden Bürger politische Rechte. Durch diese Regelung hoffte man, das soziale Missverhältnis zwischen denen, die im Parlament saßen, und denen, die das Wahlvolk ausmachten, auszugleichen. Aber die Kluft war immer noch immens: Kaufleute, Juristen, Ärzte, Apotheker, Lehrer, gefolgt von wenigen kleinen Händlern und Handwerkern, machten das Gros der Abgeordneten aus.
Der Anreiz zum Erwerb des Bürgerrechts geht zurück
Durch die 1864 eingeführte Gewerbefreiheit konnte man, nun auch ohne das Bürgerrecht zu besitzen, selbstständig ein Gewerbe führen und ein Grundstück kaufen. Mit dem Bürgerrecht erkaufte sich ein Einkommensteuer zahlender Mann nur noch den Vorteil des Wahlrechts. Das erschien vielen zu wenig. Und so sank die Zahl der Bürger und damit auch die der Wähler.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Gebühr für den Erwerb des Bürgerrechts abgeschafft. Aber das Wahlrecht blieb weiterhin an die individuelle wirtschaftliche
Lage gekoppelt, denn Voraussetzung für den Erwerb
des Bürgerrechts und damit des Wahlrechtes war der
Nachweis eines fünf Jahre hintereinander bestehenden jährlich zu versteuernden Einkommens von mindestens 1200 Mark.
Ein Arbeiter ist nun auch ein Bürger
Obwohl die wirtschaftliche Situation des Einzelnen
immer noch ausschlaggebend für das Wahlrecht war,
wollten dennoch auch Angehörige der Arbeiterschaft
das Bürgerrecht erwerben. Damit hatten die „Reformatoren“ des Wahlrechtes nicht gerechnet. Und so
tat die Hamburger Führungsschicht alles, um den steigenden Einfluss der Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie (SPD) zurückzudrängen. Denn sie war
aufgeschreckt durch die allgemeine Reichstagswahl von 1890, bei der die Sozialdemokraten mit 58,7 Prozent der Stimmen in Hamburg alle drei Reichstagswahlkreise erobert hatten. In die Hamburgische Bürgerschaft dagegen zog der erste Sozialdemokrat erst
1901 ein.
Seit 1919: endlich das Bürgerrecht für alle volljährigen
Hamburgerinnen und Hamburger
Seit dieser Zeit sind in der Bürgerschaft nicht nur
Männer, sondern auch Frauen vertreten. Außerdem
haben seitdem alle volljährigen Hamburgerinnen und
Hamburger das Wahlrecht. Damit ist der 1921 in die
Hamburgische Verfassung aufgenommene Artikel 3
Absatz 2: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ eingelöst.
Seit 2013 dürfen auch alle 16- und 17-jährigen Hamburgerinnen und Hamburger die Bürgerschaft wählen.