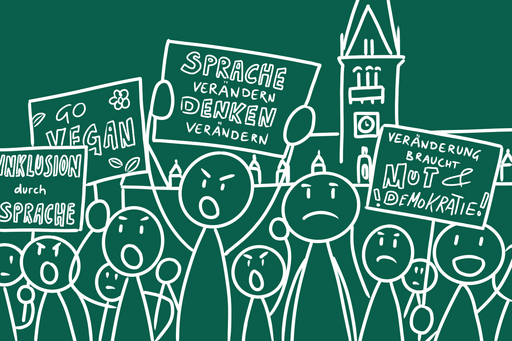1952 gab sich die Freie und Hansestadt Hamburg die heute gültige Verfassung – spät, im Vergleich zu fast allen übrigen Bundesländern der damaligen Bundesrepublik Deutschland. Einzige Ausnahme war das Land Baden-Württemberg; hier lag ein Sonderfall vor. Bayern und Hessen hatten sogar schon Ende 1946 ihre Landesverfassungen beschlossen. Vorausgegangen waren 1945 das Ende des Zweiten Weltkrieges und die Befreiung von der nationalsozialistischen Herrschaft. Hamburg wurde britische Besatzungszone, die erste Bürgerschaft von der britischen Militärregierung im Februar 1946 eingesetzt.
Der zunächst verfassungslose Zustand wurde im Mai 1946 beendet, und zwar mit Erlass einer Neuordnung noch durch die britische Besatzungsverwaltung. Diese vorläufige Verfassung wurde Ende desselben Jahres von der am 13. Oktober 1946 nun frei gewählten Bürgerschaft mit einigen Änderungen beschlossen. Ganz bewusst war diese vorläufige Verfassung als Richtung weisender Vorläufer angelegt; einen Vorentwurf für eine neue Verfassung gab es bereits 1946. Der erste echte Entwurf lag 1948 auf dem Tisch; weitere folgten in den Jahren 1949 und 1950. Erst im Juni 1952 passierte die vom Senat vorgelegte endgültige Fassung die Bürgerschaft. Drei Jahre vor der Verabschiedung der Hamburgischen Verfassung waren mit der Verabschiedung des Grundgesetzes die Grundrechte des Menschen auf Bundesebene festgeschrieben worden, sodass eine Regelung in der Landesverfassung damit entbehrlich wurde. Gleichwohl ist die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg nach deren Verkündigung am 6. Juni 1952 mehrfach geändert worden. Die umfangreichste Reform wurde 1996 vorgenommen. In insgesamt 50 Artikeln wurden Änderungen (u. a. Teilzeitstatus der Abgeordneten, Rechte der Untersuchungsausschüsse) eingebracht und es wurden Festlegungen neu eingeführt (u. a. die Richtlinienkompetenz der Ersten Bürgermeisterin oder des Ersten Bürgermeisters und die unmittelbare Wahl durch die Bürgerschaft, die Volksgesetzgebung, und die Gleichstellungsklausel). Abgeschafft wurden u.a. das Vetorecht des Senates in der Gesetzgebung und der Bürgerausschuss. Diese und weitere Verfassungsänderungen ermöglichten dann die Beschlussfassungen über ein neues Abgeordnetengesetz, ein Fraktionsgesetz, das Gesetz zu Parlamentarischen Untersuchungsausschüssen und das Gesetz über Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid.
Die Änderungen der Verfassung vom 16.5.2001 legten für Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid als Mittel der direkten Demokratie niedrigere Mindestanzahlen an Stimmen fest. Es wurden außerdem die durchgehend weibliche und männliche Sprachregelung in den Text eingeführt und die durchgängige Nummerierung der Artikel aktualisiert. Die Änderung der Verfassung vom 16.10.2006 betraf den Artikel 4 Abs. 2. Zum ersten Mal sind in der Hamburgischen Verfassung die Bezirke und Bezirksämter genannt. Dadurch ist ihnen eine größere rechtliche Bedeutung zuerkannt. Die Verfassungsänderung vom 16.12.2008 betraf den Artikel 50 und befasste sich mit dem Volksentscheid. Die Verfassungsänderung vom 8.7.2009 befasste sich mit der Änderung wahlrechtlicher Vorschriften. Die Änderung der Hamburgischen Verfassung vom 3.7.2012 thematisierte die Aufstellung der jährlichen Haushaltspläne hinsichtlich des gleichmäßigen Abbaus des strukturellen Defizits (Art. 72a). Die Änderung vom 19.2.2013 der Hamburgischen Verfassung beschäftigte sich mit der Dauer der Wahlperiode (Art. 10). Die Änderung vom 13.12.2013 der Hamburgischen Verfassung befasste sich mit den „Prozenthürden“ bei den Wahlen zu den Bezirksversammlungen (Art. 4 Abs. 2) und zur Bürgerschaftswahl (Art. 6 Abs. 2). Das 16. Gesetz zur Änderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 1.6.2015 (HmbG-VBL. S. 102) betraf die Einfügung eines sogenannten Bürgerschaftsreferendums in Art. 50 Abs. 4b sowie Folgeänderungen in den Abs. 6 und 7, die es Senat und Bürgerschaft erlauben, Volksentscheide über Fragen von grundsätzlicher und gesamtstädtischer Bedeutung herbeizuführen. Und die am 1.1.2017 in Kraft getretene Änderung vom 20.7.2016 (HmbGVBl. S. 319) regelt die Einrichtung des Amtes einer oder eines vom Senat unabhängigen Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (Art. 60a). Zuletzt wurde im November 2020 Artikel 56 durch Artikel 1 des Gesetzes (HmbGVBl. S. 559) neu gefasst:
„Die Verwaltung ist an Gesetz und Recht gebunden. Sie ist dem Wohl der Allgemeinheit und den Grundsätzen der Bürgernähe und Transparenz verpflichtet. Sie macht die bei ihr vorhandenen Informationen zugänglich und veröffentlicht gesetzlich bestimmte Informationen, soweit dem nicht öffentliche Interessen, Rechte Dritter oder gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Das Nähere regelt ein Gesetz."
Die letzten Änderungen stammen aus dem Jahr 2025 und betreffen die Wahl der Mitglieder des Rechnungshofes (Artikel 71), eine Stärkung des sogenannten "Richterwahlausschusses" (Artikel 63) und die Aufnahme von Krediten (Artikel 72).