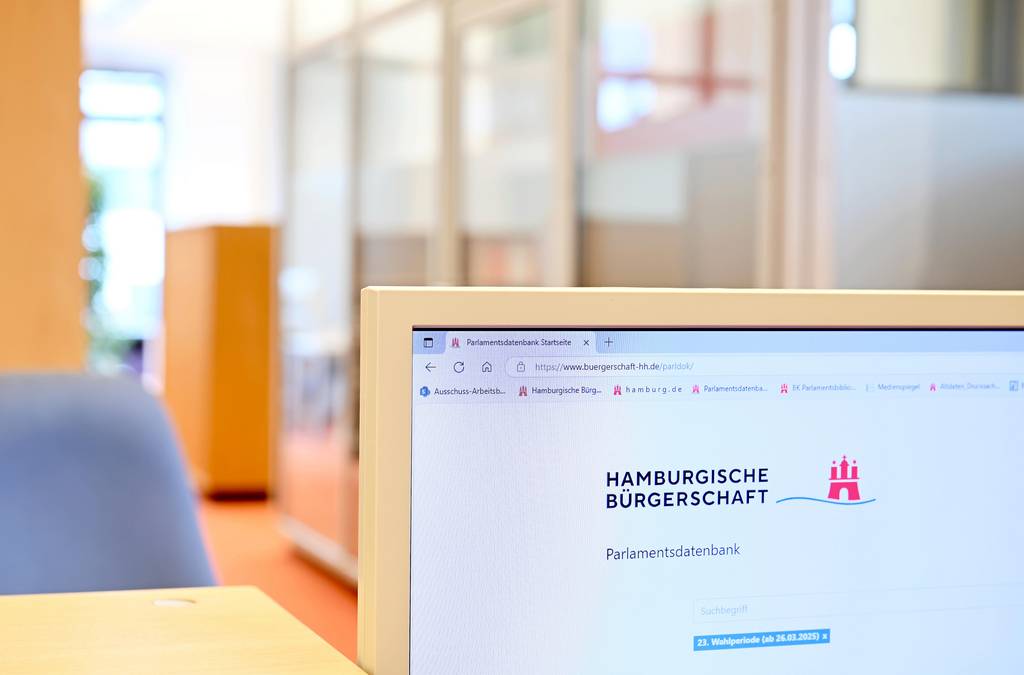Die Bürgerschaftssitzung
Die Bürgerschaft tagt mit Ausnahme der Schulferien
in der Regel alle zwei Wochen mittwochs ab 13.30
Uhr im Hamburger Rathaus. Die Sitzungen „sollen in
der Regel nicht über 22.00 Uhr ausgedehnt werden“ (Anlage 1 zur BürgGO). Auch wenn die politischen Entscheidungen an anderen Stellen – Senat, Fraktionen,
Ausschüssen – ausgearbeitet und vorbereitet werden
–, so ist die Bürgerschaftssitzung doch der wichtigste
Ort parlamentarischer Demokratie: Hier werden von
den Fraktionen und dem Senat eingebrachte Anträge
und Gesetzentwürfe beschlossen, über die Berichte
aus den Ausschüssen befunden und Argumente von
Regierung und Opposition öffentlich ausgetauscht.
Die Debatten zwingen die Vertreterinnen und Vertreter des Senats und der Mehrheitsfraktionen, die Regierungspolitik zu erläutern und gegen Argumente
aus der Opposition zu verteidigen, wodurch Willensbildung und Entscheidungsprozess gegenüber der Öffentlichkeit transparent werden.
„Die Sitzungen der Bürgerschaft sind öffentlich.“
(Art. 21 HV)
Jede Bürgerin und jeder Bürger, auch Kinder, Jugendliche und die Presse können bei der Bürgerschaftssitzung zuhören. Da es aber nur eine begrenzte Anzahl
von Plätzen gibt, muss man sich eine kostenlose Einlasskarte besorgen.
Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat zusätzlich die
Möglichkeit, die Debatte in der Bürgerschaft online live
zu verfolgen:
https://www.hamburgische-buergerschaft.de/buerger-schaft-live/
Die Videoaufzeichnungen sind später auch in der Mediathek abrufbar: https://mediathek.buergerschaft-hh.de/
Wenn ein Zehntel der Abgeordneten eine nicht öffentliche Bürgerschaftssitzung beantragt und die Bürgerschaft dieses beschließt, darf kein Publikum anwesend sein (Art. 21 HV). In solchen Fällen „dürfen nur Mitglieder, Senatsvertreterinnen oder Senatsvertreter sowie die von der Sitzungspräsidentin oder dem Sitzungspräsidenten zugelassenen Personen im Sitzungssaal verbleiben“ (§ 25 Abs. 3 BürgGO).
Während der Bürgerschaftssitzungen herrschen auf der Zuhörenden-Tribüne klare Verhaltensregeln: Buhrufe, Klatschen und sonstige Meinungsäußerungen sind untersagt (§ 51 BürgGO). Wird trotzdem gestört, kann die Sitzungspräsidentin oder der Sitzungspräsident die Zuschauenden-Tribüne räumen lassen und die Sitzung unterbrechen. In diesem Fall kann sogar die Polizei gerufen werden, denn Unruhestiftung ist eine strafbare Handlung.
Tipp:
Die Termine und Themen der Bürgerschaftssitzungen finden Sie im Internet unter www.ham-burgische-buergerschaft.de
und in den Schaukästen in der Rathausdiele. Anmeldungen und
Einlasskarten zu einer Bürgerschaftssitzung
können postalisch über: Hamburgische Bürgerschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll,
Rathaus, 20095 Hamburg, telefonisch unter:
42831-2424 erfolgen.
Auf der Website:
https://www.hamburgische-buergerschaft.de/barrierefreiheit/
können sich Besuchende außerdem über barrierefreie Zugänge ins Rathaus und die Bürgerschaft
informieren.
Ablauf der Bürgerschaftssitzung
„Die Bürgerschaft legt zu Beginn jeder Sitzung auf Empfehlung des Ältestenrats fest:
-
Welche Punkte der Tagesordnung in welcher Reihenfolge beraten werden sollen,
-
Wie mit den sonstigen Punkten der Tagesordnung verfahren werden soll, wobei – abgesehen von Wahlen – Vertagungen (...) nur von einer eintägigen auf die nächste Sitzung zulässig sind,
-
Wie die außerhalb der Aktuellen Stunde (...) und des Zeitbedarfs für geschäftliche Vorgänge verfügbare Zeit verteilt werden soll“ (§ 26 Abs. 1 BürgGO).
„Der Ältestenrat soll bei seiner Empfehlung anstreben, dass 1. grundsätzlich jeweils neun Punkte beraten werden, (...) 2. genügend Zeiten für Wahlen, Abstimmungen und die sonstige geschäftliche Behandlung von Vorlagen verbleibt“ (§ 26 Abs. 2 BürgGO).
Eine Bürgerschaftssitzung kann durch Beschluss der Bürgerschaft vertagt werden. Allerdings dürfen dringliche Senatsanträge nicht vertagt werden (§ 28 Bürg- GO).
Die Beratung eines Themas, das auf der Tagesordnung einer Bürgerschaftssitzung stand, ist beendet, wenn es dazu auf der entsprechenden Bürgerschaftssitzung keine Wortmeldungen mehr gibt. Doch, wenn nach Schluss der Beratung eine Senatsvertreterin oder ein Senatsvertreter zu diesem bereits beendeten Thema das Wort ergreift, ist die Beratung wieder eröffnet (§ 29 Abs. 1 und Abs. 2 BürgGO).
Um beschlussfähig zu sein, müssen mehr als die Hälfte der Abgeordneten im Plenarsaal anwesend sein. Doch selbst, wenn weniger Abgeordnete im Plenarsaal sitzen, können Beschlüsse gefasst werden. Art. 20 Abs. 1 HV besagt:
„Die Bürgerschaft ist beschlussfähig, wenn mehr
als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Jedoch sind
alle Beschlüsse gültig, die gefasst werden, ohne dass die
Beschlussfähigkeit vor der Abstimmung oder Wahlhandlung angezweifelt worden ist“.
Für die Abstimmung stellt die Sitzungspräsidentin
oder der Sitzungspräsident die Fragen so, dass sie
sich mit „ja“ oder „nein“ beantworten lassen (§ 33
Abs. 1 BürgGO). Die Beschlüsse werden in der Regel
per einfacher Stimmenmehrheit (Art. 19 HV) und per
Handzeichen abgestimmt.
Es kann auch namentlich abgestimmt werden. Wenn
namentlich abgestimmt werden soll, kann dies „schriftlich von mindestens sechs anwesenden Mitgliedern oder
namens einer Fraktion oder Gruppe verlangt werden“ (§
36 Abs. 1 BürgGO). Kommt bei der Abstimmung eine
Stimmengleichheit heraus, bedeutet das: Ablehnung.
Stimmenenthaltungen werden nur auf Wunsch festgestellt. Zweifelt eine Abgeordnete oder ein Abgeordneter das Abstimmungsergebnis an, dann entscheidet
die Sitzungspräsidentin oder der Sitzungspräsident
darüber, ob die Abstimmung wiederholt wird (§ 34
Abs. 2 und 4 Satz 1 BürgGO).
Nachdem die Sitzungspräsidentin oder der Sitzungspräsident die Bürgerschaftssitzung eröffnet hat, stehen als erste Tagesordnungspunkte eventuell eine Aktuelle Stunde und/oder auch Wahlen an. Danach werden die übrigen Tagesordnungspunkte behandelt:
- dringliche Senatsanträge,
- Anträge,
- Große Anfragen,
- Senatsanträge und -mitteilungen,
- eventuell auch Berichte des Rechnungshofes,
- Berichte der Ausschüsse und
- Fraktionsanträge.
Die Tagesordnung der Bürgerschaftssitzung. Ein Beispiel:
Die Tagesordnung und im Nachgang auch die Protokolle
der Bürgerschaftssitzungen können auf der Homepage
der Hamburgischen Bürgerschaft eingesehen werden:
https://www.hamburgische-buergerschaft.de/dokumente/
In der Aktuellen Stunde wird über ein politisch aktuelles Thema gesprochen.
„Bei jeder Bürgerschaftssitzung können vier Fraktionen jeweils einen Gegenstand anmelden. Die Aussprache über die angemeldeten Gegenstände erfolgt in rotierender Reihenfolge der Fraktionen beginnend mit der stärksten Fraktion“ (§ 22 Abs. 1 und 2 Satz 2 BürgGO). Der besondere Reiz der Aktuellen Stunde liegt in der Bedeutsamkeit der angesprochenen Themen für die breite Öffentlichkeit, der Begrenzung der Redezeit (fünf Minuten je Rednerin/Redner in der ersten Runde, in jeder weiteren Runde nicht länger als drei Minuten und der Debattendauer (75 Minuten). Die Rede muss frei gehalten werden, eine Verlesung ist unzulässig.
„Die von Vertreterinnen und Vertretern des Senats in Anspruch genommene Redezeit bleibt dabei unberücksichtigt. Nimmt der Senat nach Ablauf der so berechneten 75 Minuten oder so kurz vor deren Ablauf, dass den Fraktionen und Gruppen eine Erwiderung nicht mehr möglich ist, noch einmal zu einem Gegenstand der Aktuellen Stunde das Wort, so ist im Anschluss hieran je einer Sprecherin oder einem Sprecher der Fraktionen und Gruppen auf Wunsch das Wort zu erteilen“ (§ 22 Abs. 3 BürgGO).
Nachdem die Aktuelle Stunde abgehalten wurde und geschäftliche Abwicklungen erfolgt sind, hat jede Fraktion eine Grundredezeit von 35 Minuten. Fraktionslose Abgeordnete dürfen fünf Minuten reden.
„Die Fraktionen erhalten einen Zuschlag zur Redezeit unter Berücksichtigung ihrer Stärke. Dabei ist anzustreben, dass jeweils neun Debatten möglich werden. Die Redezeit pro Debattenbeitrag beträgt in der Regel fünf Minuten; im Einvernehmen können Abweichungen vereinbart werden. (...) Für das Recht zur Anmeldung von Debatten gilt eine rotierende Reihenfolge der Fraktionen beginnend mit der stärksten Fraktion“ (Anlage 2 der BürgGO).
Wer über die Redezeit hinaus spricht, dem/der kann die Sitzungspräsidentin oder der Sitzungspräsident nach einmaliger Ermahnung das Wort entziehen. Der Senat darf auch mehr als 35 Minuten Redezeit in Anspruch nehmen. Dies geht allerdings zulasten der Redezeit der ihn tragenden Fraktionen.
In Bürgerschaftssitzungen werden außerdem Anträge behandelt. Die Fraktionen und auch der Senat stellen Anträge zu unterschiedlichsten politischen Themen. Einige Beispiele:
Mehr Transparenz und Bürgernähe: Hamburgs Polizei bekommt eine neue Beschwerdestelle (SPD/GRÜNE) (Drucksache 22/1930)
Wintersemester 2020 – Persönlich trotz hybrid! (CDU)
(Drucksache 22/1941)
Digitale Technik an Hamburgs Schulen jetzt mit einem Kraftakt schnell nutzbar machen (DIE LINKE) (Drucksache 22/2392)
Menschen mit Behinderungen vor sexualisierter Gewalt schützen – Runden Tisch „Sexualität und Behinderung“ auf ein neues Fundament stellen (AfD) (Drucksache 22/1960)
„Die Anträge werden auf die Tagesordnung der
nächsten Plenarsitzung gesetzt. Sie können angenommen, abgelehnt, für erledigt erklärt oder an einen Ausschuss, in besonderen Fällen auch an mehrere Ausschüsse (...) überwiesen werden“ (§ 16 Abs. 2 BürgGO).
Es kommt auch vor, dass die Antragstellerinnen und/
oder Antragsteller selbst beantragen, dass ihre Vorlage (Thema) an einen Ausschuss überwiesen werden soll.
„Anträge können nur dann für erledigt erklärt werden, wenn die Antragstellerinnen oder Antragsteller nicht widersprechen“(§ 16 Abs. 2 BürgGO).
Auch Bürgerinnen und Bürger können Fragen stellen.
Brennt Bürgerinnen und Bürgern ein Thema unter den
Nägeln, von dem sie meinen, dieses müsste durch eine
Anfrage in der Bürgerschaft zur Sprache kommen,
können sie sich an Abgeordnete ihres Vertrauens wenden und mit ihnen den Fall besprechen. Die Abgeordneten haben Abgeordnetenbüros und Sprechzeiten.
Deren Kontaktdaten sind in den Fraktionsgeschäftsstellen im Rathaus oder auf den jeweiligen Homepages zu erhalten. Die Abgeordneten sind zwar nicht
verpflichtet, auf die Anregungen von Bürgerinnen und
Bürger einzugehen, oftmals tun sie dieses aber.
Die Bürgerschaftskanzlei
Die Bürgerschaftskanzlei ist die Serviceeinheit der Bürgerschaft mit Sitz im Rathaus, die sowohl den Abgeordneten als auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht. So erstellt sie z.B. täglich für die Abgeordneten einen Pressespiegel und bietet so den Abgeordneten eine große Auswahl von aktuellen Artikeln, insbesondere aus der örtlichen Presse, zu politischen Tagesereignissen in Hamburg und im Umland sowie zu personenbezogenen Themen von Politikerinnen und Politikern.
Die Bürgerschaftskanzlei unterstützt die Präsidentin der Bürgerschaft bei der Durchführung ihrer Verwaltungsaufgaben – so z.B. der Vorbereitung der Sitzungen oder bei Anfragen aus der Bevölkerung. Außerdem hilft sie den Abgeordneten bei ihrer parlamentarischen Arbeit. So berät sie in juristischen Fragen. Sie führt Protokoll in den Sitzungen, bereitet Bürgerschaftsempfänge vor, betreut Besuchende, erstellt Informationsschriften oder auch die „Handbücher der Bürgerschaft“.