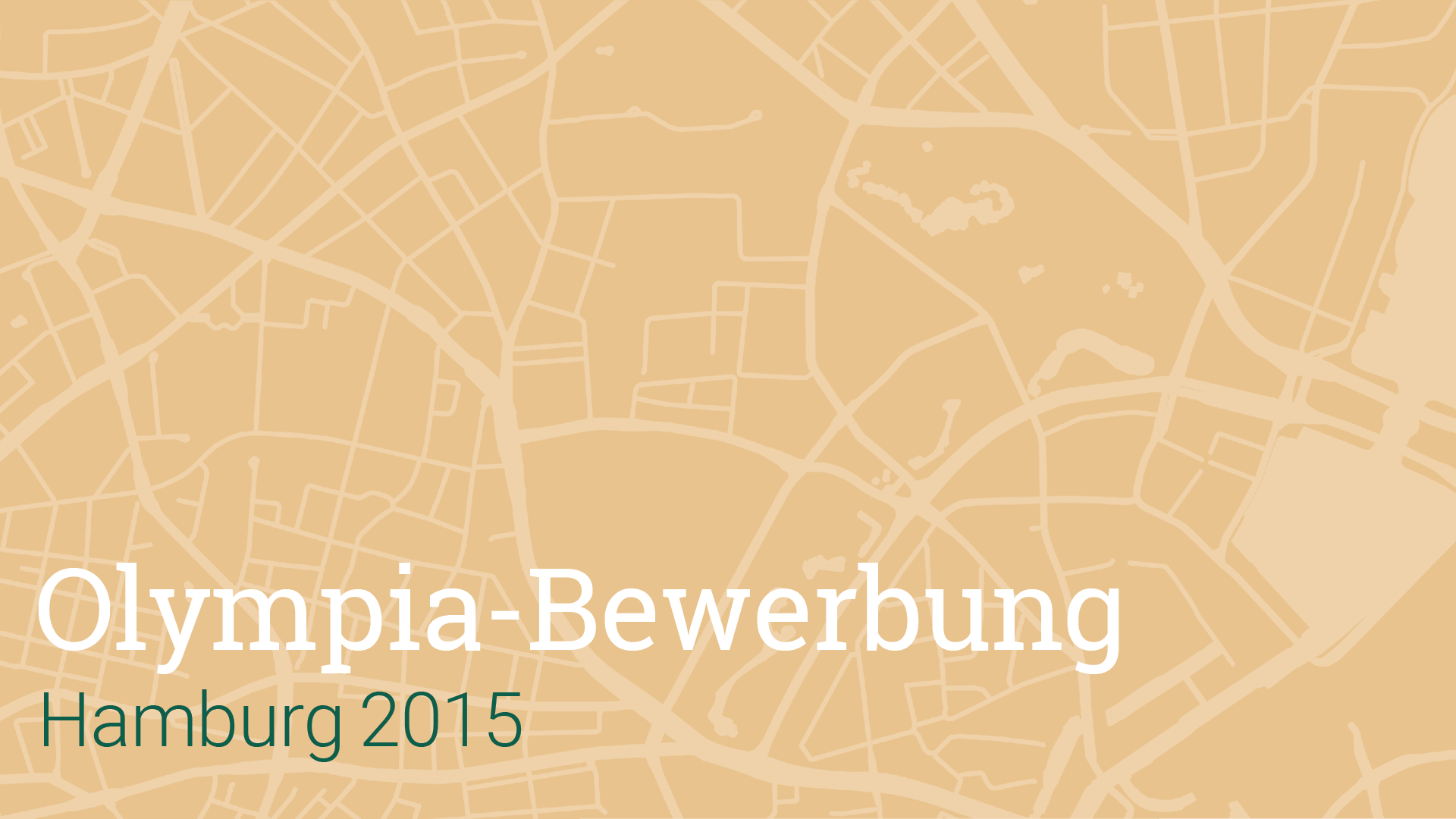Nicht nur die Bürgerschaft – auch die Hamburgerinnen und Hamburger selbst haben Einfluss auf die Gesetzgebung. So heißt es in der Hamburgischen Verfassung: „Die Gesetze werden von der Bürgerschaft oder durch Volksentscheid beschlossen“ (Art. 48 Abs. 2 HV) und: „Das Volk kann den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung eines Gesetzes oder eine Befassung mit bestimmten Gegenständen der politischen Willensbildung (andere Vorlage) beantragen“ (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel 50, Absatz 1).
Aber es gibt Einschränkungen: Unter anderem Haushaltspläne, Bundesratsinitiativen, Tarife der öffentlichen Unternehmen; Abgaben und Dienst- und Versorgungsbezüge dürfen nicht Gegenstand einer Volksinitiative sein (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel, 50, Absatz 1, Satz 2). Wollen Bürgerinnen und Bürger Hamburgs direkt Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen, so können sie folgende Schritte gehen:
1. Schritt: Volksinitiative
Die erste Hürde ist genommen, wenn 10.000 Wahlberechtigte mit ihrer Unterschrift den Gesetzentwurf oder die Vorlage unterstützen. Die Unterschriften werden dem Senat übergeben, der der Bürgerschaft das Zustandekommen der Volksinitiative mitteilt. Die Bürgerschaft befasst sich mit dem Anliegen und kann den Rechnungshof um Stellungnahme zu finanziellen Auswirkungen der Volksinitiative bitten.
„Die Volksinitiatoren erhalten Gelegenheit, das Anliegen in einem Ausschuss zu erläutern“ (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel 50, Absatz 2). „Sofern die Bürgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Unterschriften das von der Volksinitiative beantragte Gesetz verabschiedet oder einen Beschluss gefasst hat, der der anderen Vorlage vollständig entspricht, können die Volksinitiatoren die Durchführung eines Volksbegehrens beantragen“ (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel 50, Absatz 2, Satz 4).
2. Schritt: Volksbegehren
Für das Volksbegehren können die Volksinitiatoren den Gesetzentwurf oder die Vorlage in überarbeiteter Form einreichen. Damit sind nicht nur redaktionelle Änderungen gemeint, es können auch Widersprüche und Unklarheiten ausgeräumt werden. „Der Senat führt das Volksbegehren durch. Die Volksinitiatoren sind berechtigt, Unterschriften auf eigenen Listen zu sammeln. Das Volksbegehren ist zustande gekommen, wenn es von mindestens einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten unterstützt wird“ (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel 50, Absatz 2, Satz 6 bis 8). Die Bürgerschaft befasst sich mit dem Anliegen des Volksbegehrens. Die Volksinitiatoren können das Anliegen in einem Ausschuss erläutern. „Sofern die Bürgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der Unterschriften das vom Volksbegehren eingebrachte Gesetz verabschiedet oder einen Beschluss gefasst hat, der der anderen Vorlage vollständig entspricht, können die Volksinitiatoren die Durchführung eines Volksentscheides beantragen. Sie können den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage hierzu in überarbeiteter Form einreichen“ (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel 50, Absatz 3, Satz 3 und 4).
3. Schritt: Volksentscheid
Beantragen die Initiatoren den Volksentscheid, legt der Senat „den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage dem Volk zur Entscheidung vor. Die Bürgerschaft kann einen eigenen Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage beifügen. Der Volksentscheid findet am Tag der Wahl zur Bürgerschaft oder zum Deutschen Bundestag statt. Auf Antrag der Volksinitiative kann der Volksentscheid über einfache Gesetze oder andere Vorlagen auch an einem anderen Tag stattfinden. Findet der Volksentscheid am Tag der Wahl zur Bürgerschaft oder zum Deutschen Bundestag statt, so ist ein Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage angenommen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden zustimmt und auf den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage mindestens die Zahl von Stimmen entfällt, die der Mehrheit der in dem gleichzeitig gewählten Parlament repräsentierten Hamburger Stimmen entspricht. (...) Steht den Wahlberechtigten nach dem jeweils geltenden Wahlrecht mehr als eine Stimme zu, so ist die Ermittlung der Zahl der im Parlament repräsentierten Hamburger Stimmen nach den Sätzen 10 und 11 die tatsächliche Stimmenzahl so umzurechnen, dass jeder Wahlberechtigten und jedem Wahlberechtigten nur eine Stimme entspricht. Findet der Volksentscheid nicht am Tag der Wahl zur Bürgerschaft oder zum Deutschen Bundestag statt, so ist er angenommen, wenn die Mehrheit der Abstimmenden und mindestens ein Fünftel der Wahlberechtigten zustimmt“ (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel 50, Absatz 3).
Es werden nur Stimmen berücksichtigt, die Einfluss auf die Sitzverteilung im Parlament haben (gültige Landeslistenstimmen) und die nicht auf Wahlvorschläge entfielen, die an der Fünfprozenthürde scheitern. Hinsichtlich der Wahlen zum Bundestag wären derzeit nur die Zweitstimmen maßgeblich. Finden Volksentscheide außerhalb von Wahlen statt, gilt das Quorum von mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten und der einfachen Mehrheit der Abstimmenden für den Volksentscheid. Drei Monate vor einer allgemeinen Wahl in Hamburg dürfen keine Volksbegehren und Volksentscheide stattfinden (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel 50, Absatz 5).
Die Bürgerschaft kann, ggf. auch auf Antrag des Senats, ein Gesetz beschließen oder einen sonstigen Beschluss fassen, der vom Volksentscheid abweicht. Dieser Beschluss tritt jedoch erst drei Monate nach seiner Verkündung im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt in Kraft – und auch nur dann, wenn nicht innerhalb dieser Frist 2,5 Prozent der Wahlberechtigten eine erneute Volksabstimmung verlangen (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel 50, Absatz 4 und 4a). Hamburgs Wahlberechtigte können per Volksentscheid auch Verfassungsänderungen herbeiführen.
Änderungen der Hamburgischen Verfassung werden wie die Verabschiedung von Gesetzen behandelt. „Die Verfassung kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut der Verfassung ausdrücklich ändert oder ergänzt“ (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel 51, Absatz 1). Allerdings kann der Volksentscheid über eine Verfassungsänderung ausnahmslos nur am Tag einer Bürgerschafts- oder Bundestagswahl stattfinden. „Verfassungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Abstimmenden und mindestens zwei Dritteln der in dem gleichzeitig gewählten Parlament repräsentierten Hamburger Stimmen“ (Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, Artikel 50, Absatz 3).
Das Bürgerschaftsreferendum
Im Juni 2015 wurde im Artikel 50 der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg der Absatz 4b aufgenommen: das Bürgerschaftsreferendum. Mit diesem Referendum kann die Bürgerschaft auf Vorschlag oder mit Zustimmung des Senats einen Gesetzentwurf oder eine andere politische Frage von grundsätzlicher und gesamtstädtischer Bedeutung dem Volk zur Abstimmung stellen. Eine solche grundlegende Richtungsentscheidung war z.B. 2015 die Frage, ob sich Hamburg um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2024 bewerben sollte.
Die Bürgerschaft kann nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl beschließen, ein Bürgerschaftsreferendum durchzuführen. Dadurch wird sichergestellt, dass eine breite politische Mehrheit in der Bürgerschaft der Meinung ist, dass es sich um eine gewichtige Grundsatzentscheidung handelt. Das Instrument kann also nicht beliebig eingesetzt
werden. In dem Bürgerschaftsreferendum können auch Initiativen eine aktive Rolle übernehmen. Eine Volksinitiative kann ihren Vorschlag zum selben Gegenstand als Gegenvorlage zur Abstimmung stellen, wenn sie von fünf Prozent der Wahlberechtigten unterstützt wird.
Die Frist für die Unterschriftensammlung beträgt drei Wochen und erfolgt außerhalb von Schulferien. Hat die Volksinitiative bereits die Stufe zum Volksbegehren erreicht, hat sie dieses Quorum bereits erfüllt und muss keine weiteren Unterschriften sammeln. Zusätzlich haben Initiativen die Möglichkeit, eine Stellungnahme im Informationsheft, das alle Abstimmungsberechtigten zugesendet bekommen, abzugeben. Hierfür müssen sie die Unterstützung von 10.000 Wahlberechtigten beibringen. Um das politische Meinungsspektrum abzubilden, kann die Bürgerschaft auch den Abdruck der Stellungnahme einer Initiative beschließen.
Für das Zustandekommen gelten dieselben Anforderungen, wie bei einem durch Volksinitiative und Volksbegehren initiierten Volksentscheid. Ergänzend gilt für ein Bürgerschaftsreferendum zu einer Verfassungsänderung, das nicht an einem Wahltag durchgeführt wird, dass mindestens die Hälfte der Wahlberechtigten an der Abstimmung teilnehmen und zwei Drittel der Abstimmenden zustimmen müssen. Haben die Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerschaftsreferendum die Abstimmungsfrage bejaht, kann innerhalb der Wahlperiode, zumindest aber für drei Jahre kein neues Volksabstimmungsverfahren zu dem Gegenstand durchgeführt werden. Volksabstimmungsverfahren zum selben Gegenstand, die nicht als Gegenvorlage beigefügt wurden, ruhen bis zum Ablauf dieser Sperrfrist. Damit wird eine gewisse Beständigkeit der Grundsatzentscheidung gewährleistet.